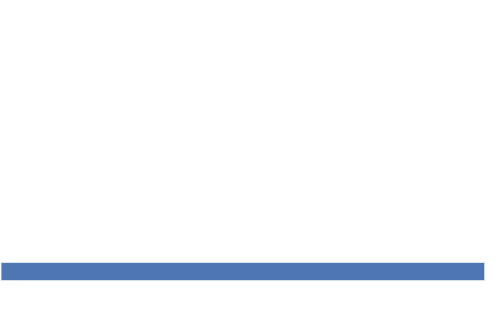Nichts, so scheint es, ist unsteter und flüchtiger als das Glück. Eben noch glaubten wir es in unserem Besitz, schon verschwimmen seine Konturen und bald bleibt nichts zurück, außer jenem biografischen, aber gesichtslosen Moment vielleicht, den das Glück in unserer Seele zu hinterlassen vermochte, dessen gewahr zu werden wir unfähig sind. Weder die althergebrachten Glaubensversprechen noch die großen Verheißungen der Moderne sind tauglich, unser Glück zu konservieren.
Selbst die kühnsten Versuche, ihm auf Dauer habhaft zu werden, scheitern wie alle anderen ad infinitum. So wird uns die Jagd nach dem Glück zum Desaster und gleicht der Strafe des Sisyphos, der von den Göttern dazu verurteilt ist, unablässig einen Felsblock einen Berg hinauf zu wälzen, von dessen höchstem Punkt der Stein von selbst wieder hinunterrollt. Endlich am Gipfel angelangt, auf dem das Glück thront – man könnte sagen, das Weh des Lebens überwunden – entgleitet uns dieses höchste Gut, das Endziel unseres Strebens, wie Aristoteles meinte, und der Gang unserer Geschichte beginnt von Neuem. Das Glück lässt sich nicht greifen, und während sich der Glücksjäger nach der Sehnsucht verzehrt, endlich glücklich zu sein, ist er dem Tod näher als dem Leben. Doch wozu der Philosoph durch allerhand Wortgirlanden dekoriert, sich zu äußern bemüßigt fühlt, das kommt nicht nur ihm, sondern bisweilen auch anderen in den Sinn: Dass nämlich der Mensch gar nicht zum dauerhaften Glück bestimmt ist, dass sein Leben also über die weiteste Strecke glücklos bleiben wird. Wie hat es Arthur Schopenhauer einst so treffend formuliert: „Kommt zu einem schmerzlosen Zustand noch die Abwesenheit der Langeweile; so ist das irdische Glück im Wesentlichen erreicht.“ Was aber, wenn unser Glück nichts ist, das dem Leben erst hinzukommen und aus dem Fluss desselben herausragen müsste; kein Monument besonderer Schönheit, der die Seele auf außergewöhnliche Weise zu rühren vermag, nichts, was dem Leben nicht schon apriori innewohnte? Dann warten wir vergeblich, obwohl das Gesuchte die ganze Zeit vor unseren Augen liegt. Doch Heilung naht! Der Weg zum »wahren« Glück, so tönt es von jeher aus den Hallen der Glücksgurus und spirituellen Führer, führt vom äußeren Glück als dem Glück, das noch hinzukommt, zum inneren Glück als dem Glück, das immer schon da ist. Lediglich die Einsicht, dass sich auch dieses Glück unserem epistemischen Zugriff entziehen könnte, will sich nicht so recht einstellen. Doch sie liegt nahe: Dass eine unbegrenzt verlängerte Empfindung überhaupt aufhören würde, empfunden zu werden, also gar nicht mehr im Bewusstsein existieren würde; dass mithin ein bestimmter Inhalt, der immer in unserem Bewusstsein wäre, schlichtweg unbemerkt bliebe, weil wir uns dessen Nichtsein gar nicht vorstellen könnten, mithin sein Vorhandensein nicht mit der Vorstellung seines Fehlens vergleichen und von ihr unterscheiden könnten, das ist ein Verdacht, der nicht nur Thomas Hobbes und Moritz Schlick gekommen ist. Horribile dictu: Das Glück, das dem Leben hinzukommt, lässt sich nicht greifen und jenes, das ihm dauerhaft innewohnt, bemerken wir nicht. Ein Befund, der es leicht vermag, uns ins Unglück zu stürzen.
Nicht aber den, der einsieht: Des Menschen Glück, wie sein Leben, gleicht der Aporie des Philosophen. Widersprüchlich in seinen Momenten und ausweglos in seiner Gesamtheit, absurd und fantastisch zugleich; ein Prinzip unseres Daseins überhaupt – nicht nur das des Glücks.
Für eine Philosophie des gelingenden Lebens empfehlen wir die Sommerakademie in der Toskana ☞☞