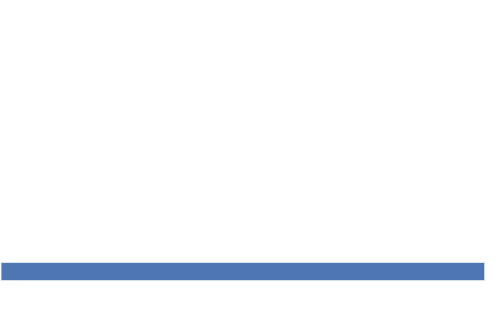Ein herrliche, inspirierende und überaus freundschaftliche philosophische Woche liegt hinter uns. Wir möchten uns bei unseren Mitreisenden und Studierenden von Herzen bedanken: Für ihre Begeisterung und Anstrengung, ihr Wohlwollen und ihre Freude!
Erneut eine intellektuelle Welterfahrung außergewöhnlicher Art. Was wir erlebt haben, neben all den Genüssen der Toskana? Die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, philosophisch gedeutet aus zwei Perspektiven, Standpunkte, die man nicht zugleich einzunehmen vermag. Und dennoch: Zwei Arten und Weisen mit den Phänomenen des Wirklichen umzugehen, wie sie fantastischer kaum sein könnten – Gottfried Wilhelm Leibnizens ›Monadologie‹ und Arthur Schopenhauers ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹.
In dem einen Fall, mithin im Fall Leibnizens, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, nichts als ein von Gott geschöpftes Universum unendlich vieler, beseelter, in sich selbst geschlossener Einzelwesen, den Monaden, den fensterlosen, auf ewig voneinander getrennten, immateriellen metaphysischen Punkten. Zugleich aber, dieses ganze Universum spiegelnd, sind sie mit allem überhaupt zutiefst verwoben: prästabiliert. Denn die Blaupause der Schöpfung, die Hintergrundfolie dieser unserer Welt, ist ein von Gott vollständig vorausgedachtes, logisch widerspruchsfreies, begriffliches Gebilde, in dem alles mit allem aufs Beste, mithin harmonisch zusammenklingt. Sie, die Schöpfung, ist, mit anderen Worten gesagt, die beste aller logisch möglichen. Dass es in ihr nichtsdestoweniger Übel gibt – ein Quantum, das dem einen oder anderen sogar die Zornesröte ins Gesicht steigen lässt –, liegt daran, dass Gott, will er überhaupt schöpfen, einzig und allein zu schöpfen imstande ist, was moralisch unvollkommen ist, mithin einen Mangel an Gutem enthält. Schlicht und ergreifend deshalb, weil alles Vollkommene mit Gott identisch ist und das, was miteinander identisch ist, kann nicht voneinander verschieden sein.
In dem anderen Fall, mithin im Fall Schopenhauers, ist die Welt, von der wir selbst ein Teil sind, zunächst und eigentlich nichts als Vorstellung. Dasjenige, das wir gemeinhin als das uns gegenüberliegende, empirische, kausal geordnete und sich in Raum und Zeit aufspannende Wirkliche wahrnehmen. Die Blaupause dieses Wirklichen liegt nicht wie noch bei Leibniz in Gott – den es bei Schopenhauer gar nicht mehr gibt –, sondern allein im Subjekt, mithin im Geist, im Bewusstsein. Subjekt und Objekt sind daher untrennbar miteinander verwoben. Vorstellendes und Vorgestelltes bedingen einander, denn Bewusstsein ist stets Bewusstsein von etwas. Ohne Subjekt, keine Welt und ohne Welt, kein Subjekt. Doch auch bei Schopenhauer droht nicht der Absturz in die Dunkelheit der Illusion, auch wenn der Preis hoch ist, denn das, worin alle Vorstellung ihren Ursprung hat, ist Wille. Weltwille; das An-sich, das dem Für-uns zugrunde liegt, dasjenige, das dem Schleier der Maya transzendent ist, aber zugleich sein Anfang. Zwei Reiche, die erkenntnislogisch auf ewig voneinander getrennt sind, wie noch bei Kant? Nicht bei Schopenhauer, denn im Unterschied zu Kant tritt eine Figur auf, die Bürgerin beider Reiche zu sein vermag: der Leib. Im Leib nämlich objektiviert sich der Wille. Der Realgrund der Tatsache, dass wir zutiefst bedürftige, mithin Mängelwesen sind und einmal dies wollend, einmal das von der einen misslichen Lage in die nächste gewuchtet werden. Spielbälle dieses Willens, dieses blinden Triebs sind wir, dessen individuiertes Wollen in dauerndem Konflikt zueinandersteht. Aneinandergekettet wie die Sklaven auf den Galeeren der Handelsgesellschaften des 19. Jahrhunderts leiden wir am gemeinsamen Dasein. Für immer? Für immer! Mit Ausnahme derer, die mehr zu sein vermögen als bloße Fabriksware der Natur. Diejenigen, die dazu in der Lage sind, die platonischen Ideen zu schauen, die unvermittelte Vorstellung des Willens, und die sich in dieser Schau selbst loswerden, die mithin willenlose Subjekte sind – einen Wimpernschlag lang. Das Mittel der Wahl: die Kunst. Das Werk des Genius. Es wiederholt die platonischen Ideen und stellt sie uns vor Augen. Doch letztlich nur ein Quietiv, nichts von Dauer. Der Spiegel der Welt, der wir in jenen raren Momenten sind, muss zerbrechen. Denn die endgültige Überwindung unseres Sklavendienstes am Willen, des Willens zum Leben – die Überwindung allen Wollens, der Bedürfnisse und des Leidens –, liegt nicht in der Bejahung desselben, die ihm nur scheinbar den Giftzahn zieht, den Stachel aus dem Fleisch des Vorstellenden reißt, sondern einzig und allein in seiner Verneinung. Den Willen zum Leben verneinen, das aber heißt, den Unterschied zwischen mir und allem anderen aufzuheben: Auslöschung des vorstellenden, für sich selbst bestehenden Subjekts. Um es in freier Assoziation mit Gottfried Wilhelm Leibniz, die Sommerakademie 2023 beendend und an den Anfang unserer Reise zurückkehrend zu sagen: Das Ende aller Schöpfung. Der Untergang der Monade. Das Verschwinden eines ganzen Universums.