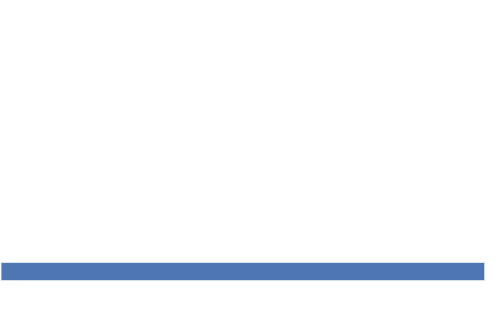Gedanken zum späten Jahr
Früh brechen die Nächte an in dieser Zeit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ob zum letzten Mal? Wer weiß das schon. Und inmitten des Getriebes, des Wahnsinns der Besinnlichkeit, halten wir Ausschau. Stille. Ein Riss zwischen Tageslicht und Dunkel. Da hört man sie schreien: Geschäfte schreien, wir retten dich; Karrieren schreien, wir retten dich; Politiker:innen schreien, wir retten dich; Religionen schreien, wir retten dich; Wissenschaften schreien, wir retten dich; Familien schreien, wir retten dich; Freunde schreien, wir retten dich. Die ganze Welt Geschrei. Fensterlos möchte man sein, für einen Augenblick, abgeschnitten von aller Erfahrung. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr fühlen. Ein metaphysischer Punkt unter metaphysischen Punkten. Doch sich selbst vor Augen gestellt, ein Kaleidoskop des Zweifels:
"Ich weiß nicht, wer mich in die Welt gesetzt hat, noch was die Welt ist, noch was ich selber bin; ich bin in einer furchtbaren Unwissenheit über alle Dinge; ich weiß nicht, was mein Leben ist, was meine Sinne sind, was meine Seele ist, ja selbst jener Teil von mir, der das denkt, was ich sage, der über alles und über sich selbst nachdenkt und sich nicht besser erkennt als das Übrige. Ich sehe diese furchtbaren Räume des Weltalls, die mich umschließen, und ich finde mich an einem Winkel dieser unermeßlichen Ausdehnung gebunden, ohne zu wissen, warum ich gerade an diesen Ort gestellt bin und nicht an einen anderen, noch warum mir die kleine Zeitspanne, die mir zum Leben gegeben ist, gerade an diesem und nicht an einem anderen Punkt der ganzen Ewigkeit zugeordnet ist: der Ewigkeit, die mir voraufgegangen ist und jener, die mir folgt. Ich sehe auf allen Seiten nur Unendlichkeiten, die mich umschließen wie ein Atom und wie einen Schatten, der nur einen Augenblick dauert und nicht wiederkehrt. Alles, was ich weiß, ist, daß ich bald sterben muß, aber was ich am allerwenigsten kenne, ist dieser Tod selbst, dem ich nicht entgehen kann. Wie ich nicht weiß, woher ich komme, so weiß ich auch nicht, wohin ich gehe; und ich weiß nur, daß ich beim Verlassen dieser Welt für immer entweder in das Nichts oder in die Hand eines erzürnten Gottes falle, ohne zu wissen, welche von diesen beiden Bedingungen für ewig mein Los sein muß."1
Doch während die Paukenschläge des Lebens die Welt der trivialen Einsichten in Trümmer legen, steigt Gelassenheit auf. Ihr Zusammenklang ist verräterisch; gibt Kunde vom großen Prinzip hinter allen Erscheinungen: Harmonie. Einheit in der Vielheit, Ordnung in der Unordnung, Schönheit in der Hässlichkeit. Und eben hier hebt sie an. So wie eine Melodie, die nur aus harmonischen Intervallen und Akkorden besteht, gar nicht als harmonisch empfunden werden kann und wie wir das Licht erst durch die Schatten zu erkennen vermögen, so bedarf es auch im Leben der Dissonanzen, der Schatten. Sie nämlich tragen den Imperativ der Herrlichkeit: ihre unablässige Forderung nach Auflösung. Indem wir also im Denken und Handeln danach trachten, das Schwere mit dem Leichten, das Bittere mit dem Süßen, das Enge mit dem Weiten, die Verzweiflung mit der Hoffnung, die Angst mit dem Mut, die Traurigkeit mit der Freude, den Hass mit der Liebe, das Tiefste mit dem Höchsten, in sorgfältiger Abstimmung zusammenzuführen, entsteht das Meisterwerk unseres Lebens.
Früh brechen die Nächte an in dieser Zeit. Stille. Ein Riss zwischen Tageslicht und Dunkel. Jetzt hören wir ihn, den Klang unserer ruhmreichen Komposition, der das Geschrei der Welt verstummen lässt. Ein Augenblick. Doch "alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit"2.
1 Pascal, Blaise: Fragment 194. 2 Nietzsche, Friedrich: Zarathustra.